Jan Gympel folgt in seinem Buch “Tempo! Berliner Verkehrsgeschichte” den Verkehrswegen. Heute werfen wir einen Blick in die Zeit des Wiederaufbaus Berlins 1945-1961.
Streik bei der Reichsbahn!
Zunächst hatte die BVG in Ost wie West noch ein ganz anderes Problem. In Berlin gab es seit Juni 1948 zwei Währungen gleichzeitig: die neue Deutsche Mark der Bank deutscher Länder (West) und die neue Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (Ost). Während die Westmark nicht in den Osten eingeführt werden durfte, war in den Westsektoren auch die Ostmark gültig. Diese galt jedoch im offiziellen Handel wie auf dem Schwarzmarkt schnell als nur halb so wertvoll wie die Westmark. Bald verschlechterte sich das Verhältnis sogar auf 1:4 bis 1:5. Natürlich kauften viele West-Berliner ihre Fahrscheine mit Ostmark, während die BVG Löhne und Gehälter wenigstens zum Teil in Westmark auszahlen musste. Erst am 20. März 1949 wurde die Westmark zum alleinigen Zahlungsmittel in den Westsektoren erklärt.
Solange beide Währungen parallel galten, hatten die Schaffner entsprechend mehr Geld mit sich herumzuschleppen. Danach wurde zum Problem, dass sie an der Währungsgrenze gewechselt werden mussten. Das hatte auch Auswirkungen auf den am 1. Juni 1949 wieder eingeführten Umsteigefahrschein: Die zweite Fahrt musste in dem Währungsgebiet angetreten werden, in dem das Billet gelöst worden war. Mehr als einmaliges Umsteigen war nicht erlaubt. Die Entwertung der Fahrscheine wurde nun nicht mehr umständlich mit der Lochzange vorgenommen, sondern mit Stempeln.
Dramatischer ging es in jener Zeit bei der Reichsbahn zu: Dort hatte die Unabhängige Gewerkschaftsorganisation (UGO), die sich vom kommunistisch dominierten Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) abgespalten hatte, ab dem 21. Mai 1949 zum Streik aufgerufen. Denn noch immer wurden Eisenbahner, die in West-Berlin wohnten, vollständig in Ostmark bezahlt. Der gerade erst wieder angelaufene Interzonen-Bahnverkehr kam ebenso zum Erliegen wie der S-Bahn-Betrieb in den Westsektoren. Bei handgreiflichen Auseinandersetzungen gab es sogar Tote.
Bei den Zusammenstößen spielte eine Frage eine Rolle, die auch in den folgenden Jahren umstritten bleiben sollte: jene nach der Polizeigewalt auf dem Bahngelände. Die Reichsbahn beanspruchte diese für ihre Transportpolizei und wollte West-Berliner Polizisten den Zutritt verwehren. Im Zweifelsfall musste stets die Besatzungsmacht des jeweiligen Sektors eingreifen.
Nach einer Außenministerkonferenz der vier Alliierten wurde der Streik am 28. Juni 1949 auf deren Anordnung beendet. Die Reichsbahn zahlte ihren West-Berliner Bediensteten fortan 60 Prozent des Lohns oder Gehalts in Westmark, die restlichen 40 Prozent tauschte die West-Berliner Regierung im Verhältnis 1:1 um. Nicht in den Genuss dieser Regelung kamen Angehörige kommunistischer Organisationen. Diese hatten, wie die Reichsbahn, gegen den Streik gewettert und ihn als „UGO-Putsch“ bezeichnet. Rund 1400 Reichsbahner, gut ein Zehntel aller in West-Berlin wohnenden, wurden entlassen. Eine unabhängige gewerkschaftliche Vertretung wurde auch in West-Berlin bis zum Zusammenbruch der SED-Diktatur 1989 von der Reichsbahn nicht akzeptiert.
Die Reichsbahn hatte sich auch deshalb gegen die Bezahlung in Westmark gesträubt, weil sie davon nicht genug besaß. Subventionen des West-Magistrats konnte sie nicht erwarten, zumal sie ihrerseits keine Steuern zahlte und auch keine Beiträge zur westlichen Sozialversicherung. Für West-Berliner Reichsbahnbedienstete bedeutete dies, dass sie bis 1990 auf die Poliklinik angewiesen waren, die man im Gebäude der Reichsbahndirektion am Schöneberger Ufer eingerichtet hatte. Sowohl ambulante als auch stationäre Behandlungen wurden dort vorgenommen. Die Reichsbahndirektion selbst war im Juni 1949 in den Ostsektor verlegt worden.
Die Westalliierten entzogen der Reichsbahn nun die Zuständigkeit für alles, was nicht unmittelbar dem Fahrbetrieb diente: vor allem die „Nebengeschäfte“ wie Kioske, Läden und Gaststätten auf den Bahnhöfen, aber auch Güterhallen, Bürogebäude und Tausende von Wohnungen. Diese Liegenschaften wurden der neu errichteten Verwaltung des ehemaligen Reichsbahnvermögens übertragen, die man schließlich beim West-Berliner Finanzsenator ansiedelte.
Der Reichsbahn auch die Betriebsrechte zu entziehen, wagten die Westalliierten wohl vor allem deshalb nicht, weil dies als Vorwand für neue Störungen im Bahnverkehr mit den Westzonen hätte dienen können. Im Osten wiederum fürchtete man, mit einer Umbenennung der Reichsbahn einen Grund für die Wegnahme der Betriebsrechte zu liefern. Dies sollte schon deshalb vermieden werden, weil man so meinte, mit der Reichsbahn in West-Berlin immer „einen Fuß in der Tür“ zu haben.
Die Reichsbahnteile in den bisherigen Westzonen wurden am 7. September 1949 zur Deutschen Bundesbahn. Zuvor war am 23. Mai 1949 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (BRD) in Kraft getreten und aus den drei Westzonen ein Staat geworden. Im Gegenzug wurde die Sowjetzone am 7. Oktober 1949 zur Deutschen Demokratischen Republik (DDR), die Ost-Berlin als ihre Hauptstadt beanspruchte, obwohl das Gebiet Groß-Berlins gemäß den 1944/45 von den Alliierten getroffenen Vereinbarungen ausdrücklich nicht zur Sowjetzone gehörte und einen Sonderstatus als Viersektorenstadt bekommen hatte. Derweil der Westen an dieser Rechtsauffassung bis zur Wiedervereinigung 1990 festhielt, wurde der Ostsektor schrittweise immer stärker in die DDR integriert und sein Sonderstatus von den dortigen Machthabern weitgehend ignoriert.

Dieses Plalat von 1950 bewirbt den Marshallplan, der zur wirtschaftlichen Erholung der Bundesrepublik entscheidend beitrug, © akg-images
Nicht nur aus politischen Gründen legte man in West-Berlin größten Wert auf die Verbundenheit zur hier gern weiterhin „Westdeutschland“ genannten Bundesrepublik: Von ihr war West-Berlin finanziell vollkommen abhängig. Die Blockade hatte den Westsektoren wirtschaftlich schwer geschadet. Immer wieder wurde der Status West-Berlins von der Gegenseite angefochten; die Zugangswege blieben unsicher. So fiel auch das „Wirtschaftswunder“ in Berlin etwas kleiner aus, obwohl natürlich auch West-Berlin vom Wiederaufbauprogramm der USA profitierte, das als „Marshall-Plan“ bekannt wurde.
Angesichts der Konkurrenz und Konfrontation von Ost und West innerhalb einer Stadt, wurde Bauen in Berlin fortan zum Teil des Kalten Krieges. Dabei hofften die meisten Menschen auf eine rasche Wiedervereinigung, die von beiden Seiten offiziell angestrebt wurde. Zugleich bemühte sich der Osten auf dem Gebiet des Verkehrs um Abgrenzung. Offiziell sprach man dabei gern von „Störfreimachung“. Die möglichst starke Isolierung West-Berlins von seinem Umland war aber auch dazu gedacht, der halben Stadt das Leben noch schwerer zu machen.
So wurde am 14. Oktober 1950 der Bus- und Straßenbahnverkehr zwischen West-Berlin und dem nun in der DDR gelegenen Umland eingestellt. Zuvor war ein Schaffner der West-BVG von der Ostpolizei verhaftet worden. Zunehmend wurden Straßen an der innerstädtischen Sektorengrenze, vor allem aber an der Zonengrenze zum Umland abgeriegelt. Für den Kraftfahrzeugverkehr geschah dies teils auch von Westen aus, um die damals fast alltäglichen Entführungen von Menschen durch östliche Agenten zu erschweren.
Schon am 1. Mai 1950 war in der DDR ein Zollgesetz in Kraft getreten, demzufolge der Binnengüterverkehr West-Berlin nicht mehr berühren durfte. Dafür wurde im Eiltempo der Havelkanal gebaut, der eine Umgehung West-Berlins ermöglichte: Im Mai 1951 begonnen, fand bereits am 28. Juni 1952 die Einweihung statt. Zugleich verkürzte die neue Wasserstraße den Weg und ermöglichte den Verkehr mit 1000-Tonnen-Schiffen, auf welche die Schleuse Spandau noch nicht ausgelegt war.
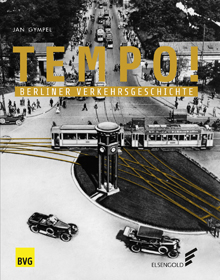 Der Textauszug entstammt Jan Gympels Buch “Tempo! Berliner Verkehrsgeschichte”, Elsengold Verlag
Der Textauszug entstammt Jan Gympels Buch “Tempo! Berliner Verkehrsgeschichte”, Elsengold Verlag
Der Journalist Jan Gympel hat zahlreiche Bücher und Artikel zur Berliner Verkehrsgeschichte veröffentlicht.


Neueste Kommentare